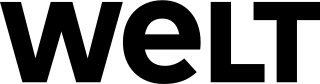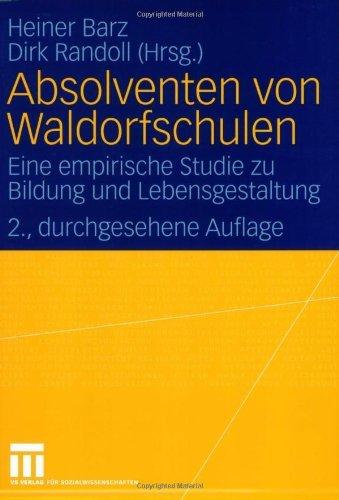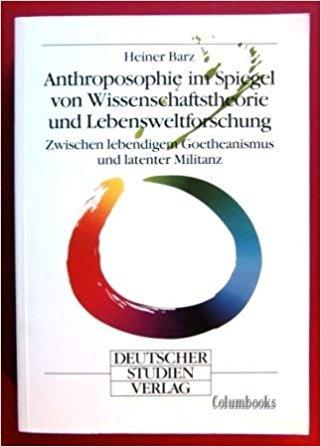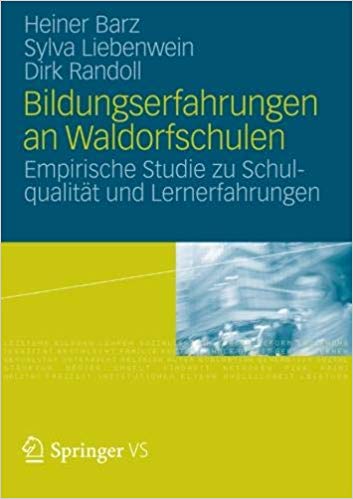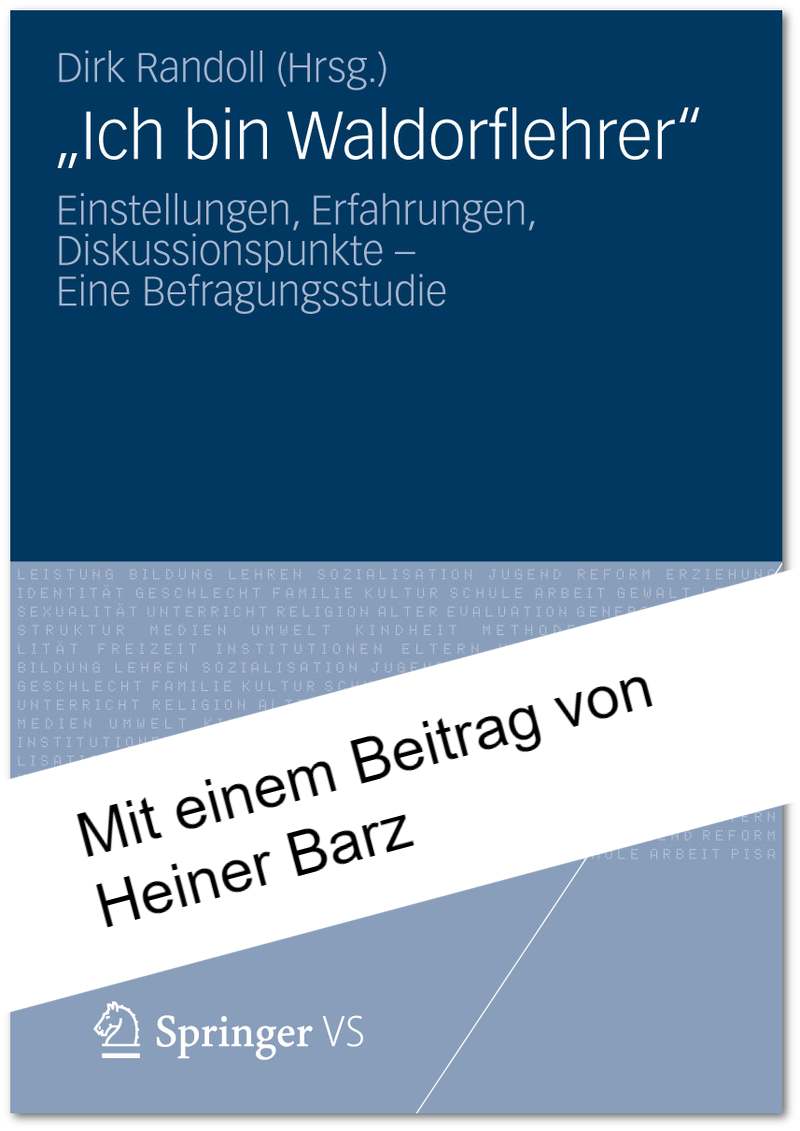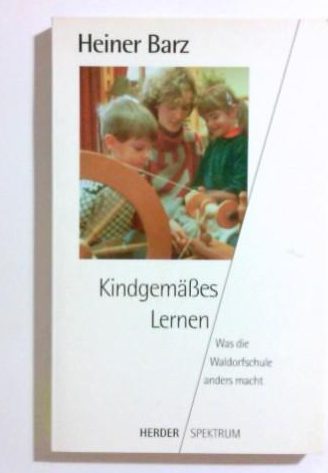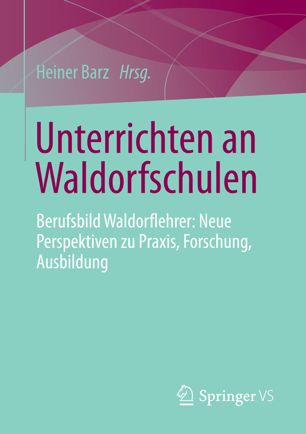Die Waldorfpädagogik gehört zu den prominenten Konzepten der sog. Reformpädagogik, die im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern eine kulturelle Erneuerung der Gesellschaft durch eine neue Erziehung auf den Weg bringen wollte. Ihre philosophischen und psychologischen Grundlagen wurzeln in der Anthroposophie, einer weltanschaulichen Strömung, die von Dr. Rudolf Steiner (1861-1925) begründet wurde.
Die Anthroposophie hat in vielen gesellschaftlichen Bereichen nachhaltig Erneuerungsimpulse entwickelt, die bis in die heutige Zeit wirken. Zu nennen sind etwa die biologisch-dynamische Landwirtschaft, Heilmittel und natürliche Kosmetika, neue Ansätze im Bankwesen (Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken, GLS), die Schaffung einer neuen Bewegungskunst (Eurythmie), eine neue Christologie (Christengemeinschaft) oder die Gründung der ersten deutschen Privatuniversität (Witten-Herdecke).
„Waldorf global: Eine Schule geht um die Welt“ (05.09.2019) – Zum Videobeitrag
„100 Jahre Waldorfschule – Steiners Erben im Aufbruch“ (25.02.2019) – Zum Radiobeitrag
„Von Stuttgart in die Welt: Das Konzept Waldorfschule“ (05.09.2019) – Zum Radiobeitrag
„Fack ju Bildungsghetto!“ (20.02.2018) – Zum Artikel
„100 Jahre Waldorfschule – Steiners Erben im Aufbruch“ (16.09.2019) – Zum Radiobeitrag
„Waldorfabsolventen – Sie warten nicht ab, sondern packen zu“ (19.05.2014) – Zum Artikel
Interview mit Heiner Barz: „Waldorfschulen bieten Antworten auf die heutigen Schulprobleme“ (15.08.2013) – Zum Interview
„Waldorfschüler: Mit mehr Begeisterung beim Lernen und näher dran an den Anforderungen der Gegenwart“ (27.09.2012) – Zum Artikel
„100 Jahre Waldorfschule“ (26.08.2019) – Zum Radiobeitrag
Interview mit Heiner Barz: „Die Lehre Steiners ist kein Evangelium mehr“ (26.09.2012) – Zum Interview
„Namen tanzen, fit in Mathe – Waldorf im Vorteil“ (26.09.2012) – Zum Artikel
„Spätfolgen von Waldorfschulen“ (07.04.2007) – Zum Artikel
„Grundschule mit Astralleib“ (01.10.2012) – Zum Artikel
„Selbstsicher dank Waldorfschule“ (01.10.2005) – Zum Artikel
„Hassfach Eurythmie“ (23.04.2007) – Zum Artikel
Publikationen zur Waldorfpädagogik von Heiner Barz
Videoclips mit Heiner Barz
Waldorfschüler lernen freudiger, finden ihre Schule überwiegend einladend und fühlen sich zu zwei Dritteln individuell von den Lehrern wahrgenommen. Außerdem sehen sie sich in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt, d.h. sie lernen in der Schule ihre Stärken kennen. Dies ist ein Ergebnis der ersten großen empirischen Studie zu Bildungserfahrungen an den Waldorfschulen, die der Bund der Freien Waldorfschulen auf einer Pressekonferenz am 26.09.2012 in Berlin vorgestellt hat.
Andreas Schleicher, Direktor des Direktorats für Bildung bei der OECD und internationaler Koordinator der PISA-Studien, präsentierte die Studienergebnisse.